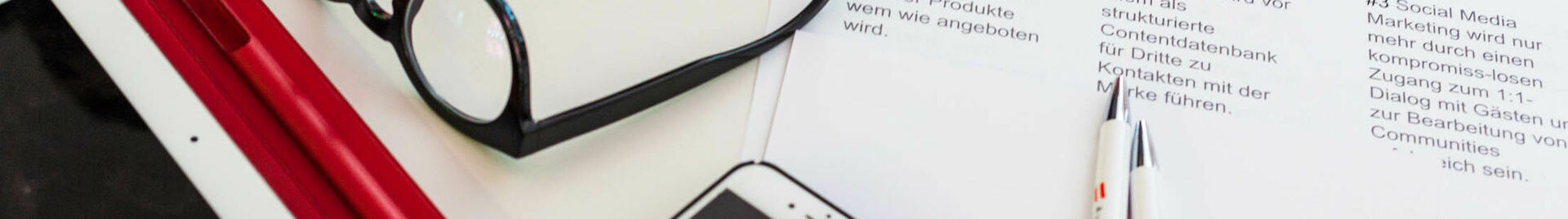
Ausgabe vom 03.04.2025

News rund um die Tourismusforschung
Ausgabe vom 03.04.2025
ÖW Tourismusforschung & Data Analytics
Hochrechnung Nächtigungsstatistik: Bisherige Wintersaison 2024/25 im Plus mit 51,3 Mio. Nächtigungen (+1,5 %) und 14,2 Mio. Ankünften (+3,2 %).
Der Februar schließt mit 17,1 Millionen Nächtigungen (-7,2 %) und 4,1 Millionen Ankünften (-3,6 %) rückläufig im Vergleich zum Vorjahr. Der Rückgang kann auf mehrere Faktoren zurückgeführt werden. 2024 war ein Schaltjahr, der Februar hatte somit einen Tag mehr als 2025. Zu diesem Kalendereffekt kommen Ferienverschiebungen in wichtigen Herkunftsmärkten wie z.B. die Krokusferien in Belgien, die 2024 in den Februar fielen und 2025 in den März fallen. Auch in den Niederlanden verschieben sich die Winterferien und fallen 2025 teilweise in den März. In Bayern gab es ebenfalls eine Verschiebung der Schulferien (von Februar 2024 zu März 2025).
Die bisherige Wintersaison (November 2024 bis Februar 2025) verzeichnet insgesamt 51,3 Millionen Nächtigungen (+1,5 %) und 14,2 Millionen Ankünfte (+3,2 %). Ankünfte von Gästen aus dem Ausland stiegen um 3,1 %, während die inländischen Ankünfte um 3,5 % zulegten. Ähnlich zeigten sich Nächtigungszuwächse sowohl bei internationalen Gästen (+1,0 %) als auch bei inländischen Nächtigungen (+3,5 %). Besonders positiv entwickelten sich die Übernachtungen in gewerbl. Ferienwohnungen (+4,3 %) und 5/4-Stern Hotels (+3,5 %).
Unter den Top 15 Herkunftsländern aus dem Ausland kam es in der bisherigen Wintersaison (November 2024 bis Februar 2025) zu den größten relativen Nächtigungszuwächsen aus der Slowakei (+21,5 %), den USA (+15,8 %), Kroatien (+12,7 %), Frankreich (+11,5 %), Polen (+10,8 %) und Tschechien (+10,5 %).
Das bisherige Kalenderjahr (Jänner bis Februar) bilanziert mit 8,1 Millionen Ankünften (+1,2 %) und 33,1 Millionen Nächtigungen (-2,5 %).
Hier geht’s zur Hochrechnung
International
Digitale Kommunikation im Tourismus: Was wir aus der Schweizer DMO-Umfrage 2025 lernen können
Eine aktuelle Umfrage unter 79 Schweizer Tourismusorganisationen (DMOs) liefert wertvolle Einblicke in den Status quo digitaler Kommunikation, die auch für den österreichischen Tourismus relevant sind. Besonders auffällig sind Trends in den Bereichen Social Media, Datenmanagement und der Einsatz von künstlicher Intelligenz.
Social Media ist gesetzt – aber mit klarer strategischer Zielsetzung: Instagram (97 %) und Facebook (99 %) sind nach wie vor die wichtigsten Kanäle für touristische Kommunikation – auch in kleineren Organisationen. TikTok gewinnt stark an Bedeutung (bereits 41 %), besonders bei der Ansprache junger Zielgruppen. LinkedIn wird vor allem für B2B und Partnerkommunikation genutzt. Ableitung für Österreich: Auch für heimische Destinationen bietet sich ein strategischer Ausbau kanalübergreifender Kommunikation an – inklusive Monitoring neuer Formate wie Reels, Shorts oder TikTok-Kampagnen. Wichtig ist, die Zielsetzungen klar zu definieren: Reichweite, Interaktion, Buchung?
Budgets bleiben knapp – klare Priorisierung ist gefragt: Die Medianbudgets für digitales Marketing (z. B. Social Media oder Suchmaschinenmarketing) sind überschaubar – der Ressourcendruck ist auch in Österreich bekannt. Umso wichtiger ist eine effiziente Mittelverwendung, etwa durch gezieltes Testing und Performance-Auswertung. Empfehlung für Österreich: Fokus auf Content, der nachweislich wirkt – z. B. nutzergenerierter Content, Micro-Influencing, Videoformate oder datenbasierte Kampagnenaussteuerung über DSPs.
Künstliche Intelligenz – erste Schritte, viel Potenzial: Vor allem kleinere Organisationen setzen KI derzeit zur Textgenerierung und Bildoptimierung ein, während größere DMOs bereits mit Chatbots oder CRM-Automatisierung experimentieren. Ableitung für Österreich: Die intelligente Integration von KI in Contentproduktion, Gästeservice und Datenmanagement kann Zeit sparen und Qualität sichern – sofern Kompetenzen und Prozesse vorhanden sind. Weiterbildung und Pilotprojekte wären sinnvolle nächste Schritte.
Fazit: Die Umfrage macht deutlich, dass digitaler Erfolg im Destinationsmarketing nicht nur von Technologie, sondern vor allem von klarer Zielsetzung, kanaladäquatem Content und laufender Professionalisierung abhängt. Für Österreichs Tourismus bedeutet das: Potenziale liegen in der Weiterentwicklung bestehender Strukturen – mit Fokus auf smarte Ressourcennutzung und strategisch eingesetzten Innovationen.
Hier geht’s zur Publikation
Rückgang der Nachfrage nach USA-Reisen aufgrund von Donald Trumps Politik
Aktuelle Berichte deuten darauf hin, dass die Nachfrage nach Reisen in die USA aufgrund der politischen Maßnahmen und Rhetorik von Präsident Donald Trump zurückgeht. Europäische Reisende, insbesondere aus Deutschland und Dänemark, überdenken ihre Reisepläne in die Vereinigten Staaten. Beispielsweise hat der dänische Reisende Kennet Brask seine geplante Reise nach Florida abgesagt, nachdem er Trumps Verhalten während eines Treffens mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelenskiy beobachtet hatte.
Gründe für die Zurückhaltung:
- Politische Spannungen: Trumps Vorschläge, wie die mögliche Annexion Grönlands, haben insbesondere in Dänemark für Unmut gesorgt.
- Strengere Einreisepolitik: Verschärfte Grenzkontrollen und restriktive Visa-Bestimmungen tragen zur Verunsicherung bei potenziellen Reisenden bei.
Auswirkungen auf den Tourismus:
Laut Daten des US National Travel and Tourism Office (NTTO) gingen die Besucherzahlen aus Westeuropa im Februar um 1 % im Vergleich zum Vorjahr zurück. Besonders auffällig ist der Rückgang aus Ländern wie Slowenien (26 %), der Schweiz und Belgien.
Reaktionen der Reisebranche:
- Werbeumstellungen: Einige europäische Reiseveranstalter, wie Albatros Travel in Kopenhagen, haben beschlossen, keine Marketingmittel mehr für USA-Reisen einzusetzen und konzentrieren sich stattdessen auf andere Destinationen.
- Trend zu Alternativen: Kanada erlebt einen Anstieg an Buchungen von deutschen Reisenden, die die politische Lage in den USA umgehen möchten.
Diese Entwicklungen verdeutlichen, wie politische Entscheidungen und internationale Beziehungen das Reiseverhalten beeinflussen können.
Hier geht’s zum Artikel
Unterdurchschnittliche Gehälter im deutschen Tourismussektor
Laut Daten des Statistischen Bundesamtes lag der durchschnittliche Verdienst für Vollzeitbeschäftigte mit abgeschlossener Berufsausbildung in Deutschland im April 2024 bei 3.973 Euro brutto monatlich.
Beschäftigte im Tourismussektor verdienen hingegen oft weniger:
- Hotelangestellte: Durchschnittlich 2.950 Euro monatlich.
- Reiseverkehrskaufleute: Durchschnittlich 3.454 Euro monatlich.
Einige Positionen im Tourismus weisen jedoch höhere Gehälter auf:
- Fluglotsen: Durchschnittlich 11.123 Euro monatlich.
- Flugbegleiter: Durchschnittlich 3.821 Euro monatlich.
- Kellner: Durchschnittlich 2.785 Euro monatlich.
Höhere Bildungsabschlüsse korrelieren generell mit höheren Einkommen:
- Ohne beruflichen Abschluss: Durchschnittlich 3.287 Euro.
- Mit abgeschlossener Berufsausbildung: Durchschnittlich 3.973 Euro.
- Meister-, Techniker- oder Fachschulabschluss: Durchschnittlich 5.300 Euro.
- Bachelorabschluss: Durchschnittlich 5.183 Euro.
- Masterabschluss: Durchschnittlich 6.850 Euro.
- Promotion oder Habilitation: Durchschnittlich 9.296 Euro.
Hier geht’s zum Artikel
National
Statistik Austria: Österreich – Zahlen - Daten - Fakten
Die Statistik Austria zeigt in ihrem aktuellen Bericht wesentliche Entwicklungen, die auch für den Tourismus von Bedeutung sind – insbesondere mit Blick auf Bevölkerungsstruktur, Freizeitverhalten und Mobilität.
1. Altersstruktur & Zielgruppenpotenziale
Die Zahl der älteren Menschen wächst weiter: Im Jahr 2023 waren 22,4 % der Bevölkerung 65 Jahre oder älter, Tendenz steigend. Damit gewinnt die Zielgruppe der Senior:innen als reisefreudige, aber komfort- und sicherheitsorientierte Gäste zunehmend an Bedeutung – insbesondere außerhalb der Hauptsaison. Auch die Gruppe der 50- bis 64-Jährigen ist mit 20,1 % stark vertreten, was das Potenzial für qualitativ hochwertige und kulturinteressierte Reiseangebote unterstreicht.
2. Freizeitverhalten und Reisen
Laut den Erhebungen zur Zeitverwendung (2021/22) verreisen 35 % der Bevölkerung regelmäßig, wobei der Tourismus im Inland eine zentrale Rolle spielt. Besonders bei Menschen ab 60 Jahren sind kurzfristig planbare Reisen mit hoher Servicequalität und Kulturbezug gefragt.
3. Internationale Herkunftsmärkte
Die Bevölkerung mit Migrationshintergrund macht mittlerweile 26 % der Gesamtbevölkerung aus – mit hohem Anteil aus Deutschland, den Ländern Ex-Jugoslawiens, der Türkei und zunehmend aus asiatischen Staaten. Diese Gruppen stellen potenzielle Gästezielgruppen dar, insbesondere im Besuchsreiseverkehr zu Familie und Freunden.
4. Bildung & Mobilität
Höhere Bildungsabschlüsse – besonders bei jungen Frauen – korrelieren mit einer höheren Reiseintensität, insbesondere zu kulturellen und urbanen Reisezielen. Gleichzeitig bleibt das Auto mit über 80 % Anteil das Hauptverkehrsmittel für Inlandsreisen. Damit sind gut erreichbare, regionale Angebote weiterhin ein Schlüsselfaktor für touristische Planung.
5. Klimawandel & Nachhaltigkeit
Ein wachsendes Umweltbewusstsein spiegelt sich u. a. in der steigenden Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel im urbanen Raum und der wachsenden Relevanz nachhaltiger Mobilität. Für den Tourismus bedeutet das: klimafreundliche Erreichbarkeit und ressourcenschonende Angebote werden wichtiger – besonders bei jüngeren Zielgruppen.
Hier geht’s zur Publikation
Was Menschen in der Pension am Reisen besonders schätzen
Eine aktuelle Umfrage zeigt, dass Reisen für viele Pensionist:innen ein wichtiger Bestandteil ihres Lebensstils ist. Mit dem Ausscheiden aus dem Berufsleben verändern sich nicht nur die zeitlichen Möglichkeiten, sondern auch die Erwartungen und Prioritäten beim Verreisen. Die Studie des Standard beleuchtet, was Senior:innen an Reisen besonders schätzen – und welche Aspekte für Tourismusbetriebe zunehmend relevant werden.
Flexibilität als großer Vorteil: Ein zentraler Faktor ist die neugewonnene zeitliche Flexibilität. Viele Pensionierte verreisen bewusst außerhalb der Hauptreisezeiten, um überfüllte Orte zu meiden, ruhigere Urlaubsatmosphären zu genießen und von günstigeren Preisen zu profitieren. Die Nebensaison wird damit für Destinationen immer relevanter – gerade mit Blick auf nachhaltige Auslastung.
Sicherheit, Komfort und gutes Service: Pensionist:innen legen großen Wert auf komfortable Unterkünfte, gut erreichbare Reiseziele und verlässliche Services. Auch barrierearme Infrastruktur wird zunehmend wichtig, ebenso wie medizinische Versorgung in der Nähe. Gleichzeitig bleibt das Bedürfnis nach Autonomie hoch: Viele bevorzugen individuell gestaltete Reisen anstelle klassischer Gruppenreisen.
Kulturelles Interesse und Neugier: Neben Erholung spielt bei vielen älteren Reisenden der Wunsch nach kulturellem Austausch und neuen Erfahrungen eine zentrale Rolle. Museen, Konzerte, Stadtführungen oder Kulinarikangebote stehen hoch im Kurs. Der soziale Austausch mit Gleichgesinnten – etwa bei Themenreisen oder Kursangeboten – wird ebenfalls geschätzt.
Digitalisierung erreicht auch ältere Zielgruppen: Viele Pensionist:innen nutzen inzwischen digitale Kanäle zur Reiseplanung und -buchung. Die Bedeutung von Online-Bewertungen und einfach zugänglichen Informationen steigt – doch gleichzeitig bleibt persönliche Beratung ein wichtiges Entscheidungskriterium, vor allem bei komplexeren Reisen.
Fazit: Die Zielgruppe der Pensionierten ist reisefreudig, neugierig und anspruchsvoll – aber auch loyal, wenn sie sich gut betreut fühlt. Für den Tourismus bietet sie großes Potenzial, insbesondere in der Nebensaison. Erfolgreiche Angebote setzen auf individuelle Erlebnisse, Komfort, gute Erreichbarkeit und kulturellen Mehrwert – kombiniert mit professionellem Service und echter Gastfreundschaft.
Hier geht’s zum Artikel
Neues Analysetool für neun österreichische Städte: Präzise Standortdaten zur Stärkung des Stadtmarketings
Neun Mitgliedsstädte des Dachverbands Stadtmarketing Austria – Bischofshofen, Braunau, Feldkirch, Hall in Tirol, Klagenfurt, Kufstein, Tulln, Villach und Weiz – profitieren ab sofort von einem innovativen Analysetool, dem cima.city.monitor. Dieses Instrument ermöglicht eine detaillierte Analyse von Kaufkraftströmen und Konsumverhalten, was eine fundierte Basis für strategische Entscheidungen im Stadtmarketing schafft.
Hauptmerkmale des cima.city.monitors:
- Datenbasis: Anonymisierte Transaktionsdaten aus den Jahren 2019 bis 2023, die sowohl Ausgaben der lokalen Bevölkerung als auch von Tourist:innen erfassen.
- Detaillierte Analysen: Unterscheidung des Konsumverhaltens zwischen lokalen und externen Kund:innen sowie Einblicke in die wirtschaftliche Entwicklung verschiedener Branchen wie Handel, Gastronomie, Kultur, Freizeit, Dienstleistungen und Mobilität.
- Touristische Erkenntnisse: In touristisch relevanten Städten wird zudem erfasst, aus welchen Ländern die Gäste stammen und wie sich ihre Ausgaben verteilen.
Stimmen zur Einführung des Analysetools:
- Mag. Michael Gsaller, Präsident von Stadtmarketing Austria: "Stadt- und Standortmarketing hat sich in den letzten Jahrzehnten stark professionalisiert und stellt mittlerweile ein unverzichtbares Instrument für eine koordinierte, langfristige (Innen-) Stadtentwicklung dar. Daher sind wir froh, auf fundierte Daten und Fakten zurückgreifen zu können."
- Mag. Roland Murauer, CEO von CIMA Österreich: "Diese Partnerschaft gibt Stadtmarketingorganisationen erstmals ein präzises Werkzeug zur datenbasierten Standortanalyse in die Hand."
- Oliver Gabriel, Direktor Advisors Business Development bei Mastercard: "Wir freuen uns, mit diesen Daten zielgenau zur Weiterentwicklung der österreichischen Städte beizutragen."
Die Bereitstellung des cima.city.monitors markiert einen bedeutenden Schritt für die beteiligten Städte, um ihre Stadtmarketingstrategien auf eine solide Datenbasis zu stellen und den Herausforderungen des Wettbewerbs zwischen Online- und stationärem Handel gezielt zu begegnen.
Hier geht’s zum Artikel
Nachhaltigkeit
Studie des deutschen Bundesverkehrsministeriums: Auswirkungen eines Tempolimits auf CO₂-Emissionen
Eine aktuelle Studie der Bundesanstalt für Straßen- und Verkehrswesen im Auftrag des Bundesverkehrsministeriums analysiert die potenziellen CO₂-Einsparungen durch die Einführung eines generellen Tempolimits auf deutschen Autobahnen. Demnach könnte ein Tempolimit von 130 km/h jährlich zwischen 1,3 und 2 Millionen Tonnen CO₂ einsparen, abhängig von der Einhaltung durch die Autofahrer.
Zum Vergleich: Die gesamten CO₂-Emissionen von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen auf deutschen Autobahnen beliefen sich im Jahr 2023 auf 38,7 Millionen Tonnen.
Faktoren, die den Effekt beeinflussen:
- Kontrolle und Sanktionen: Die Wirksamkeit eines Tempolimits hängt maßgeblich von der konsequenten Überwachung und Ahndung von Verstößen ab.
- Anteil von Elektrofahrzeugen: Mit zunehmender Verbreitung von Elektroautos sinkt das CO₂-Einsparpotenzial eines Tempolimits, da diese Fahrzeuge lokal emissionsfrei fahren.
Stellungnahmen:
- Michael Müller-Görnert, Verkehrsclub Deutschland (VCD): Betont, dass keine andere Maßnahme im Verkehrssektor einen vergleichbar hohen Klimanutzen habe wie ein Tempolimit auf Autobahnen.
Diese Studie liefert wichtige Erkenntnisse für die aktuelle Diskussion über die Einführung eines Tempolimits in Deutschland und dessen Beitrag zum Klimaschutz.
Hier geht’s zum Artikel




